„Ihr bumst doch!“ Das Bumsen klingt wie Bümsen. Eigentlich sollten mich die entspannte Stimmung auf meinem senffarbenen Sofa und der sächsische Dialekt meines Kumpels Ronny etwas milder stimmen, wenn er mir einen solchen Spruch an den Kopf haut. Aber der Spruch ärgert mich. Trifft mich. Und er löst einiges in mir aus. Es geht um meine Freundschaft zu Jannik. Dem heißen Jannik. Dem Jannik aus dem Gym. Dem – und das ist halt besonders wichtig – heterosexuellen und maskulinen Jannik. Hätte ich damals bei dem Gespräch mit Ronny gewusst, dass es jetzt – gut ein Jahr später im Hitzesommer – weder das senffarbene Sofa noch diese Freundschaften in meinem Leben gibt, hätte ich wohl entspannter auf die Aussage zum „Bümsen“ reagiert.
Aber fangen wir von vorn an und gehen gemeinsam ein Jahr zurück.
Über die letzten Jahre hatte sich die Freundschaft mit Jannik langsam entwickelt. Ich kannte ihn damals noch als Mitarbeiter meines Fitnessstudios. Anfänglich war es schlicht ein Nicken, wenn man sich vor Ort traf, weil man sich schließlich irgendwie vom Sehen her kannte. Später war es dann irgendwann ein Rumwitzeln mit ihm und Fred auf der Trainingsfläche, weil man – zumindest am Wochenende – auch immer die gleiche Trainingszeit hatte. Und weil das Leben nun mal so spielt, kam irgendwann der Punkt, an dem wir unsere Nummern austauschten. Und das, obwohl augenscheinlich unsere Welten sowas von weit auseinander lagen. Ich, der im Fitnessstudio gern mal zu Lady- Gaga-Beats aus seinen Kopfhörern Hüften statt Gewichte schwingt; er, der heterosexuelle Muskelkerl mit Sohn, dessen Oberarme quasi so dick sind wie meine Oberschenkel. Er, der Typ, der mit seinem Auftreten und seinem maskulinen Verhalten, direkt der „GQ“ entsprungen sein könnte; ich, der am Kiosk lieber in der „Vogue“ statt der „Auto, Motor, Sport“ blättert. Er, in der Schulzeit der Frauenschwarm und Hochleistungssportler; ich, auf der Realschule der Typ, dem „picklige, fette Schwuchtel“ hinterhergerufen wurde.
Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Laufband dabei war, meinen Puls zu steigern, als er neben mir stehend über 45 Minuten sehr private Dinge aus seinem Leben erzählte und mir dann irgendwann seine Nummer diktierte, um später noch weiter zu quatschen. Aus welchen unbekannten Gründen auch immer half es damals auf jeden Fall dabei, meinen Herzschlag zu beschleunigen.
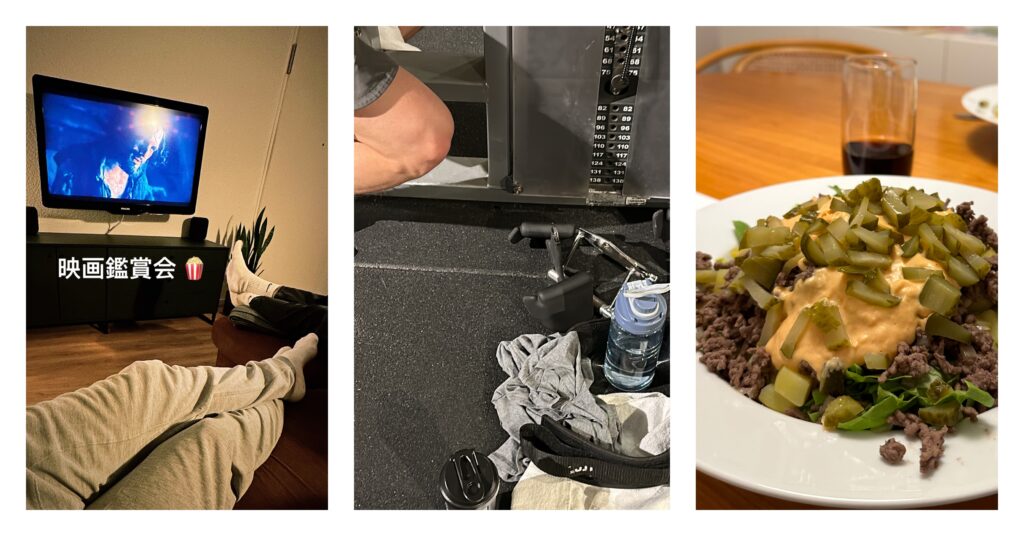
Und dann wurde der Kontakt mit der Zeit immer intensiver.
Es war die Zeit, in der wir uns gegenseitig halfen. Er schraubte an meinem Rennrad oder fuhr mit seinem Kombi und mir Möbel für meine neue Wohnung besorgen. Ich konnte dafür Bewerbungen für ihn ausdrucken oder mit Rat bei Familienchaos zur Seite stehen.
Es war die Zeit, in der ich nach der Arbeit immer mal wieder bei ihm vorbeilief, weil er direkt um die Ecke meines Büros wohnte. Regelmäßig habe ich dann mit seinem kleinen Sohn „König der Löwen“ gespielt. Ich hielt ihn hoch wie Rafiki es tat, sang in den treffendsten – oder auch mehr oder weniger treffenden – Tönen gemeinsam „Hakuna Matata“ oder sollte wie Simba brüllen.
Es war die Zeit, in der wir gemeinsam Serien auf Disney+ starteten, die – weil es das Gesetz nun mal so schreibt – nicht allein weiter geschaut werden durften. Regelmäßig bekochten wir uns an den Serientagen gegenseitig und wechselten mal auf sein graues oder mein senffarbenes Sofa.
Es war die Zeit, in der wir täglich unzählige Nachrichten bei WhatsApp hin und her schickten, um uns auf dem Laufenden zu halten, die besten Airfryer-Rezepte zu tauschen oder um die großen und kleinen Fragen des Lebens zu diskutieren.
Es war die Zeit, in der wir immer häufiger gemeinsam zum Sport und in die Sauna gingen. Anfänglich trafen wir uns nur dort und dann trainierten wir recht schnell auch gemeinsam. Er half mir mein Training zu verbessern und an meine Grenzen zu gehen. Ich hatte dafür auch im Gym immer ein offenes Ohr für seine Themen.
Es war die Zeit, in der ich mich in seiner Gegenwart immer besser fühlte. Ein so heterosexueller und sehr maskuliner Kerl, der von homosexuellen wie heterosexuellen Frauen und Männern im Gym angeschaut und angehimmelt wird, trainiert mit mir, verbringt Zeit mit mir. Öffnet sich mir. Teilt Sofa und Sorgen mit mir.
Und damit war es auch die Zeit, in der die Mickey Mouse und viele andere – eben auch Ronny – immer und immer wieder sagten, ich sei ja wohl verschossen in den Muskelberg, so viel Zeit wie wir miteinander verbringen würden. Und wiederum andere sagten, er würde mich ausnutzen, da ständig irgendwas wäre und ich immer und immer wieder für ihn zurückstecken und andere vernachlässigen würde.
Hatten sie recht? War das der Grund, warum in den letzten Wochen so viel passiert war mit Jannik und mir? Was genau ließ mich so nach Janniks Aufmerksamkeit zehren? War ich verschossen? Oder Schlimmer: Verschossen und daher mit Scheuklappen versehen? Wo kamen auf einmal all diese Gefühle her, die in meinem Kopf genauso wie in meinem Bauch verrückt spielten? Wieso wollte ich so viel Zeit mit ihm verbringen und fühlte mich währenddessen so gut?
So kam ich nicht umhin mich zu fragen: Kann es eine Freundschaft zwischen einem so maskulinen und normativ Heterosexuellen und einem Gay, wie ich einer bin, geben?
Natürlich hatte ich im Leben auch immer wieder heterosexuelle Freunde. Simon, der Nachbarsjunge: mein Sandkastenfreund im Kindergarten. Florian, der die Straße runter wohnte: mein Abenteuerfreund in der Grundschule. Und Christopher, der Typ aus dem Nachbarsdorf: mein Best Buddy in der Realschule. Aber dann war es das auch langsam schon. Und immer sehnte ich mich auch nach Freundschaften mit den Kerlen, die nicht mit mir befreundet sein wollten: Die Jungs aus meiner Klasse und dem Dorf. Sie alle waren so „Manns genug“, dass sie nicht nur Frauenschwarm waren, sondern auch die Lieblinge in der Klasse und der Dorfgemeinschaft und sich natürlich zusammenrotteten. Während ich also mit ein paar Mädchen meine engsten Freundschaften pflegte, waren es diese Jungs, die das Kommando angaben. Und dann war da auch noch Jo, der Fußball-Profi aus dem Nachbarsdorf. Der, der aufs Gymnasium ging und nur einmal zu Besuch bei uns in der Schule war. Natürlich als Begleitung vom Schul-Überflieger aus meiner Klasse. Ich weiß noch ganz genau, wie sie den Tag über der Mittelpunkt von allem waren. Dumme Sprüche, lautstark, auffällig. Wie jugendliche, heterosexuelle Kerle von der Gesellschaft immer noch gern gesehen werden. Und ich, der diesen Kerlen gegenübersaß und auf eine schon sehr ambivalente Art dazugehören wollte. Und weil das Leben oft die verrücktesten Dinge zulässt, dauerte es nicht lange, und meine Kindergartenliebe Jenni war mit Jo zusammen. Und ich auf einmal mit ihm konfrontiert. Ich musste mich mit diesem Ekel auseinandersetzen, der auf einmal mit meiner ältesten Freundin ging.
War es nicht schon genug, dass ich daheim mit der geballten Heterosexualität meiner Familie klarkommen musste? Einem Konstrukt, das so aus dem Handbuch „Der richtige Mann“ der 50er Jahre entsprungen sein könnte: Mein Vater und meine Brüder die Handwerker, die ein ganzes Haus gemeinsam bauen konnten. Die jeden Tag auf der Baustelle schufteten und ihre wirklich seltsamen Kalender mit nackten Frauen in den Werkstätten hängen hatten. Und ich dazwischen, das Nesthäkchen mit der Ansage Dachdecker oder Zimmermann zu werden, der aber schon als Kind lieber mit Barbies gespielt oder der mit seiner Baby-Born eher Vater, Mutter, Kind nachgestellt hatte. Das alles natürlich wesentlich lieber als eine Lego Ritterburg zu bauen und Kriege zu führen. Und damit weit weg von einer handwerklichen Ausbildung und noch weiter weg von der normativen Heterosexualität, die die Gesellschaft in Werbung, Film und Öffentlichkeit so gern zur Schau stellt. Was ich dann auf dem Dorf auch immer wieder zu spüren bekam.

In einer Karnevalshochburg groß geworden, gab es natürlich auch eine Funkengarde. Der natürlich alle Männer eines gewissen Alters angehörten. In der natürlich auch meine Brüder tanzten. In der natürlich auch Stippeföttche dazugehörte: Klassisch rieben sich die Männer als Teil des Tanzes also gegenseitig die Hintern mal rechts, mal links herum aneinander. Und wenig überraschend wurde ich nie gefragt, ob ich Teil der Funkengarde sein wollen würde. Obwohl ich als wenig normativ maskulines Kind und Jugendlicher – selbstredend natürlich – das beste Taktgefühl von allen Kerlen in meinem Dorf hatte. Und jedes Jahr an Karneval waren die Männer auf der Bühne, schmissen die beiden Funkemariechen hoch und rieben ihre Hintern aneinander. Ich allerdings stand allein „inner Bütt“ als Comedian oder saß im Publikum neben meinen Mädels und Jo.
Ja, Jo. Der mich dann nämlich doch irgendwie mochte und ich ihn dann auch. Dennoch stresste mich damals die neu gewonnene Freundschaft anfänglich. Ich hatte immer das Gefühl, dass jede Geste, jede Nettigkeit so ausgelegt werden würde, als wollte ich dem hübschen Fußballer nur an die Wäsche. Die ersten Male, die wir gemeinsam zum Squash wollten, habe ich ausgeschlagen aus Angst, dass er denken könnte, ich wolle ihn nur nackt unter der Dusche sehen. Oder schlimmer: ihn begrapschen. Mit der Zeit wurde das besser, auch wenn das Gefühl immer irgendwie da war. Und ich auch nie verstehen konnte, wieso er mit mir auch Dinge unternahm, wenn Jenni nicht dabei war.
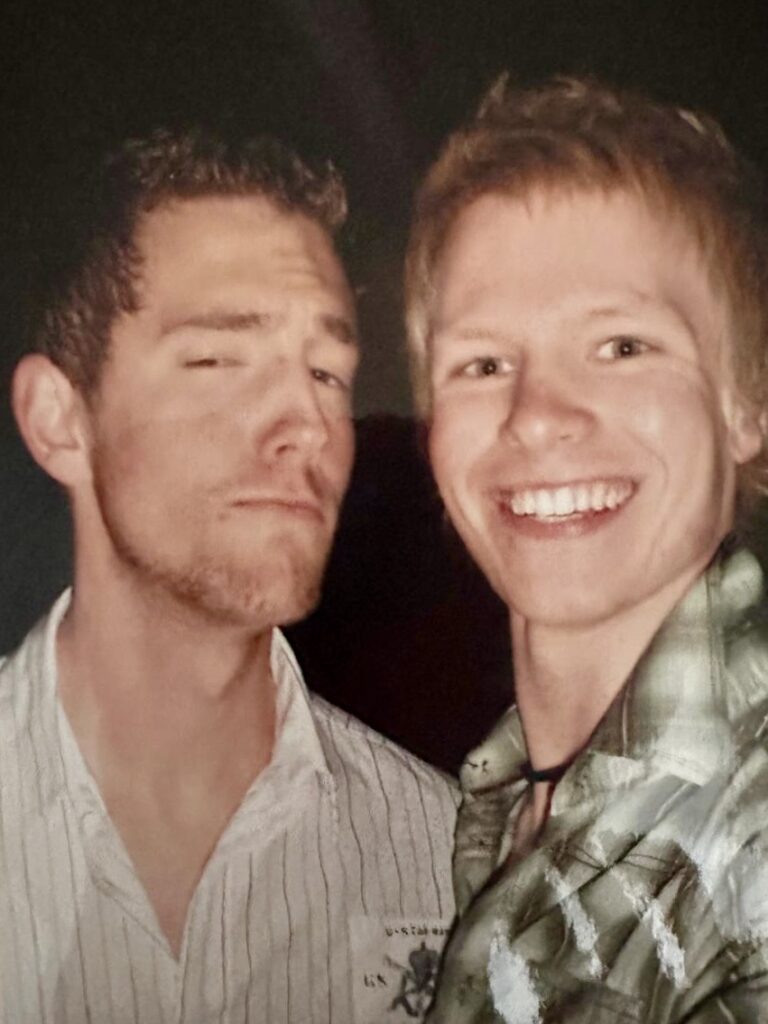


Und jetzt? Habe ich auch noch heterosexuelle Freunde. Jo ist noch immer da. Und Stupsi, der mich liebt und alles für mich tun würde. Max oder mein Bruder Tobi. Ebenfalls Heteros, die an meiner Seite sind und mich so lieben, wie ich bin. Aber das sind eben auch Männer, die genau das sagen. Die mich in den Arm nehmen. Stupsi hat sich sogar mal auf sein Motorrad geschwungen und ist direkt aus der Eifel nach Leipzig gebrettert, weil ich am Telefon zu weinen angefangen habe. Max drückt mich, wenn wir uns sehen, mindestens eine Minute lang. Solche Art von heterosexuellen Männern eben, die man sich für die ganze Welt wünschen würde.
Und dann ist da Jannik. Der Mann, der mich nach intensiven neun Monaten in denen wir gelacht und geweint haben, fallen gelassen hat, wie eine heiße Kartoffel, die 40 Minuten bei 200° Grad im Airfryer garte.
Von jetzt auf gleich war die Freundschaft von seiner Seite aus beendet. Die letzten Umzugskisten schleppte ich noch in seine neue Wohnung und dann gab es keine Antworten mehr auf meine WhatsApp-Nachrichten, keine gemeinsamen Trainings, keine Disney+-Serien, keine Sofas und Sorgen mehr. Und als wäre das nicht schon seltsam und schmerzhaft genug gewesen, wurde ich ersetzt, so wie ich – nach dem größten Wasserschaden meines Lebens – mein senffarbenes Sofa durch ein tannengrünes Cord-Sofa ersetzt hatte. Ronny und Jannik waren nun nämlich das neue Gym-Bro-Team. All jene Momente, in denen ich die beiden durch das Gym stolzieren sah, wollte ich fliehen. Im wahrsten Sinne des Wortes das Handtuch werfen und rausrennen. Ich zog mich zurück, drehte meine Musik auf den Ohren lauter und unser Grüßen beschränkte sich auf ein kaum wahrnehmbares Nicken – wenn überhaupt. Und es ging sogar soweit, dass ich die beiden auch immer und überall zusammen in der Stadt sah. Sie waren auch irgendwann so weit gegangen, dass sie in meinem Teil der Stadt, in meinem Rewe unterwegs waren und ich ihnen einfach mal nichtsahnend in die Arme lief.
„Jetzt haben die sogar die Eier in der Hose und kommen auf meine Seite der Ringe, in meinen Rewe! Zwischen deren Wohnungen und meiner liegen vier!“ tippte ich zitternd und leicht bis stark verstört eine Nachricht an meine beste Freundin Lina. Und damit startete die Zeit des Kummers und der Aufarbeitung meiner Gefühle.
Ja, ich war verliebt. Daher hatte ich auch extremen Liebeskummer. Ich wollte Adele- Musik hören, Ben & Jerry’s-Eis in mich schaufeln und unter der Decke mit Mickey Mouse liegend nicht mehr aufstehen. Aber ich war nicht verliebt in den Muskeltypen aus dem Gym. Nein, ich war verliebt in diese Freundschaft. In dieses Gefühl, dass mich ein so heterosexueller wie maskuliner Kerl meinetwegen mag und nicht das Gefühl hat, dass ich ihm nur an die Wäsche will. In dieses Gefühl, dass so ein Typ selbst nackt unter der Dusche mit mir scherzen kann, ohne sich neben mir unwohl zu fühlen. In dieses Gefühl, dass so ein Mann auf meinem Sofa sitzt, sich so sehr öffnet und Sorgen mit mir teilt und sich dann auch noch mit mir in der Öffentlichkeit zeigt und alle wissen lässt, dass wir befreundet sind. Ein Gefühl, dass ich in einer solchen Intensität noch nie gefühlt habe. Jannik hat mir etwas gegeben, nachdem ich als schwuler Junge aus der Eifel mein Leben lang eine Sehnsucht hatte. Bewusst geworden ist es mir aber erst jetzt.
Es gibt Dinge im Leben, bei denen man sich erst bewusstwird, dass man das Verlangen danach hat, wenn man sie einmal gehabt hatte. Man kann das nun ungesund, verrückt oder dumm nennen. Ist es möglicherweise auch. Aber für mich ist es wichtig, dass ich weiß, dass es einen Teil in mir gibt, der sich nach einer – sehr oft auch ungesunden – übertriebenen, normativen Maskulinität und Heterosexualität um mich herum sehnt. Nicht, um nun auf der Suche danach zu sein. Sondern um zu wissen, dass es nicht nur okay ist, so zu fühlen, sondern eben auch, um damit klar kommen zu können. Um es immer mal wieder zu reflektieren und zu hinterfragen. Im Fachjargon nennt man das übrigens internalisierte Homofeindlichkeit an der das dann liegen kann. Weil der antrainierte Hass gegen Homosexuelle so tief auch in einem selbst sitzt, gibt’s die Bereitschaft einer queeren Person, eine toxische Beziehung über die Grenzen der sexuellen Orientierung hinaus zu führen.
Ich habe jahrelang dazu gehören wollen. Mein Leben lang hatte ich das Gefühl, nicht hetero genug, nicht maskulin genug zu sein. Und dann war da der gutaussehende, muskulöse, maximal maskuline, heterosexuelle Kerl, der all diese Ideale vermeintlich erfüllt hat. Und mich Teil davon sein ließ. Der mir eine seltsame Freundschaft gezeigt hat, die ich nie für möglich gehalten hatte. Und sie dann ohne Angabe von Gründen beendet hat, was dazu führte, dass ich mir dieser Sehnsucht unter großem Leid bewusst geworden bin. Und daran nun wachsen kann. Denn ich habe natürlich immer noch viele tolle Freundschaften. Zu allen möglichen Geschlechtern. Und eben auch zu Heteromännern. Die sind halt nur anders, als Jannik es war.
Jetzt sitze ich also wieder in meinem Wohnzimmer. Diesmal allein und nicht mehr auf meinem senffarbenen, sondern tannengrünen Cord-Sofa. Ich blicke blinzelnd gegen die Sonne aus dem Fenster und freue mich auf einen Spaziergang mit Max. Wir gehen mit seinem kleinen Sohn zum Wasserpark in den Grüngürtel. Planschen. Ich bin mir sicher, dass mich Max dort wieder länger drücken wird und ich ihm dann sagen kann, dass ich froh bin, dass er in meinem Leben ist. Das Gleiche schreibe ich nun Jo, Stupsi und Tobias.
Denn am Ende ist es doch so: Ich bin maskulin auf meine Art. Und ob ich mir nun mit anderen Männern die Hintern mal rechts, mal links herum aneinander reibe oder nicht: I am, what I am. I am my own special creation.
2 Kommentare
Johannes
Danke dir Andreas für diese krass ehrlichen Worte, dieses unverblümte Zeigen deiner Person und deines Werdegangs.
Dazu gehört eine Menge Mut, so öffentlich sich berührbar zu zeigen und machen.
Danke. Liebe Grüße
Tom
Ich bin immer wieder beeindruckt von deinen Texten. Gnadenlos offen, authentisch, ungeschönt und eine Einladung in die Story einzutauchen und nachzuempfinden. Man bekommt die Möglichkeit einen Perspektivenwechsel einzunehmen und mitzufühlen.
Danke dafür!